- Jugendliche
- Fachpersonen (Schule, Jugendarbeit...)
- Eltern
-
feel-ok.ch/fnQR-Code für diese Seitehttps://www.feel-ok.ch/fn/

feel-ok.ch zeigt dir, wie du das Internet und die sozialen Medien sicher, effizient und zu deinem Vorteil nutzen kannst, damit du aus dem Web herausholst, was dir und deinen Mitmenschen gut tut. feel-ok.ch erklärt dir, wie du dich gegen die Schattenseiten der virtuellen Welt schützen kannst, um negative Erlebnisse zu vermeiden.
Inhalte
Diese Artikel interessieren unsere Leser*innen: «Anzeichen einer Onlinesucht», «Pornografie» und «Ich bin ein Star (Sexting)».
feel-ok.ch erklärt dir, wie Internet funktioniert, wie man fragwürdige Infos von guten Inhalten unterscheidet, vertieft das Thema Sex im Netz, erläutert, was die Profile der sozialen Medien wirklich bedeuten, ob Minderjährige online shoppen dürfen, wie man zweifelhafte Angebote im Internet erkennt, wie man im Internet auf der sicheren Seite bleibt und wie man sich gegen Cybermobbing schützt.
Bist du Tag und Nacht online oder immer am Gamen? Dann finde heraus, warum eine Online-/Gamesucht kein harmloses Problem ist und was du dagegen machen kannst.
Interaktiv
Hast du deinen Onlinekonsum im Griff? Teste dich selbst mit dem Onlinesucht-Test. Ob du mit hohem Risiko im Web surfst oder schlau unterwegs bist, zeigt dir das Ergebnis vom Web-Profi-Test.
Jugendliche erzählen von ihren Erfahrungen in den Videointerviews von Virtual Stories, damit du daraus deine Lehre ziehen kannst.
Hast du Fragen oder Sorgen, die deinen Onlinekonsum betreffen?
147.ch
Du kannst rund um die Uhr gratis und ohne deinen Namen zu nennen bei der Nummer 147 anrufen (auf DE, FR oder IT). Die Berater*innen von 147 hören dir zu und geben dir Rat, was du in deiner Situation machen kannst.
Safe Zone
safezone.ch berät dich professionell, anonym und kostenlos bei Fragen zur Onlinesucht.
Die Kernaussagen dieses Artikels zum Anhören in 6 Minuten.
![]() Für den Einsatz der Audiodatei mit Jugendlichen empfiehlt feel-ok.ch das Arbeitsblatt zum Thema „Fake News (Desinformationen), Fehlinformationen und Deepfakes” als didaktische Unterstützung herunterzuladen.
Für den Einsatz der Audiodatei mit Jugendlichen empfiehlt feel-ok.ch das Arbeitsblatt zum Thema „Fake News (Desinformationen), Fehlinformationen und Deepfakes” als didaktische Unterstützung herunterzuladen.
Wir sprechen über Fake News, Fehlinformationen und Deepfakes, weil sie in sozialen Medien verbreitet werden und du sicher damit in Kontakt kommst. Wie erkennst du sie? Welche Schäden können sie anrichten? Wie kannst du dich davor schützen? Beginnen wir eine spannende Reise, die deine Medienkompetenz stärkt.
Fake News sind Meldungen mit absichtlich falschen oder irreführenden Inhalten. Sie werden von Menschen oder Programmen, sogenannten Bots, in Umlauf gebracht.
Menschen, die Fake News verbreiten, wissen oder zumindest vermuten, dass ihre Inhalte falsch oder zweifelhaft sind. Man spricht in diesem Fall auch von Desinformation. Bei Fehlinformationen ist das anders: Wer schreibt, glaubt, etwas Richtiges zu kommunizieren, irrt sich dabei aber.
Warnsignale für Fake News sind Meldungen, die starke negative Emotionen auslösen, sofort geteilt werden wollen, keine zuverlässigen oder überprüfbaren Quellen für ihre Behauptungen angeben oder bei denen die Autorenschaft unbekannt oder unqualifiziert ist.
Fake News, Fehlinformationen und Warnsignale
In sozialen Medien verbreiten sich zunehmend auch Deepfakes. Als Deepfakes werden Videos, Bilder und Audioaufnahmen bezeichnet, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Deepfakes werden unter anderem erstellt, um Fake News mehr vermeintliche Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Deepfakes zu erkennen, wird immer schwieriger. Gegebenenfalls können folgende Aspekte darauf hinweisen: unnatürliche Gesichtsbewegungen, verschwommene oder übermässig glatte Gesichtsmerkmale, Hände mit zusätzlichen oder fehlenden Fingern, unleserlichen Text, unnatürliche Stimmen oder unpassende Hintergrundgeräusche. Doch selbst wenn das Video keine Fehler enthält, besteht immer noch ein gewisses Risiko, dass es mit KI generiert wurde.
Was Deepfakes sind und welche Hinweise darauf hindeuten
Grundsätzlich kann jede Person auf Fake News und Fehlinformationen hereinfallen. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass unser Gehirn mit Denkmustern arbeitet, die schnelle Entscheidungen auf Basis weniger Informationen ermöglichen. Diese Denkmuster werden kognitive Verzerrungen genannt. Es gibt viele davon. Ein Beispiel ist der Bestätigungsfehler, der besagt, dass man eher Informationen akzeptiert, die zur eigenen Meinung passen. Ein weiteres Beispiel ist der Vertrautheitsfehler, der besagt, dass eine Information umso glaubwürdiger erscheint, je öfter man sie hört.
Die Verfasser*innen von Fake News nutzen diese und weitere Denkmuster aus, damit ihre Meldungen überzeugend wirken.
Kognitive Verzerrungen machen uns anfällig dafür, Fake News und Fehlinformationen zu glauben. Soziale Medien verstärken dieses Phänomen durch Filterblasen und Echokammern. Filterblasen entstehen, weil Algorithmen nur Inhalte anzeigen, die den eigenen Interessen und Erwartungen entsprechen. Echokammern entstehen, wenn man nur Menschen mit gleichen Ansichten folgt. So gerät man in eine sogenannte Blase oder Bubble. Wenn dort immer wieder die gleichen einseitigen Inhalte und Kommentare auftauchen, können Fake News und Fehlinformationen die Gedanken, Gefühle und Überzeugungen der Follower leicht beeinflussen.
Soziale Medien: Filterblasen und Echokammern
Zu begreifen, wie die Denkmuster des Gehirns und die sozialen Medien funktionieren, hilft dir, neuen Meldungen mit einer kritischen und vorsichtigen Haltung zu begegnen. Um Fake News und Fehlinformationen aufzudecken, musst du aber zu einem Fakten-Detektiv werden.
Um zu prüfen, ob eine Information dem aktuellen Wissensstand entspricht, solltest du z.B. recherchieren, ob auch andere zuverlässige Quellen darüber berichten. Zuverlässige Quellen zeichnen sich aus u.a. durch anerkannte Autorenschaft, belegbare Quellen, Aktualität, sachliche Sprache, Neutralität bei kontroversen Themen und klare Trennung von Fakten und Meinungen. Unzuverlässige Quellen erkennt man hingegen u.a. an emotionalen oder dramatisierenden Formulierungen, Verallgemeinerungen oder Beleidigungen von Andersdenkenden.
Andere zuverlässige Quellen prüfen
Um herauszufinden, ob eine Information stimmt, kannst du bei vielen Gesundheitsthemen nachsehen, was die wissenschaftliche Literatur dazu sagt. Besonders wertvoll sind dabei Metaanalysen und Reviews, die Erkenntnisse aus mehreren Studien zu einem bestimmten Thema zusammenfassen (siehe hierzu die Evidenzpyramide). Um diese Studien zu finden, kannst du die Deep-Research-Funktion von ChatGPT, Gemini, Perplexity oder Claude verwenden oder bestehende Datenbanken wissenschaftlicher Publikationen konsultieren. Anschliessend kannst du die KI nutzen, um diese Studien zu übersetzen oder zu interpretieren.
Wissenschaftliche Studien heranziehen
Wenn du ein verdächtiges Bild siehst und herausfinden möchtest, ob es in einem falschen Zusammenhang gezeigt wird, kann dir eine Rückwärtssuche helfen – auch „Reverse Image Search“ genannt. Eine einfache Möglichkeit dazu bietet die Google-Bildersuche.
Auch Influencer*innen können Fehlinformationen und Fake News verbreiten, auch jene, die beliebt sind und professionelle Videos produzieren. Die kritische und vorsichtige Haltung sollte daher auch für Influencer*innen gelten. Untermauern sie ihre Aussagen mit verlässlichen Quellen? Unterscheiden sie transparent zwischen geprüften Fakten, Meinungen und persönlichen Erfahrungen? Haben sie kommerzielle Interessen, die die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen anzweifeln lassen? Diese Fragen solltest du dir bewusst stellen, bevor du ihre Empfehlungen zu wichtigen Themen akzeptierst.
Sich gegen Fake News zu schützen ist wichtig, weil Fake News deine Aufmerksamkeit wollen – oft durch Angst, Wut oder Empörung. Wer solchen Nachrichten ausgesetzt ist, kann sich psychisch belastet fühlen. Besonders gefährlich wird es, wenn Fake News und Fehlinformationen falsche medizinische oder gesundheitliche Ratschläge geben, durch die Menschen krank werden oder sogar sterben.
Fake News können auch politische Entscheidungen und Abstimmungen beeinflussen sowie die Gesellschaft in Gruppen spalten, die kaum mehr miteinander kommunizieren. Wenn Konflikte, Hass und fehlende Empathie zur Normalität werden, kann das schwerwiegende Folgen für die Solidarität innerhalb der Gesellschaft und für einzelne Personen haben.
Da Fake News, Deepfakes und Fehlinformationen schädlich sein können, solltest du dazu beitragen, dass sie sich nicht verbreiten. Wenn du eine Nachricht siehst, die starke Emotionen in dir auslöst oder bei der du dir nicht absolut sicher sein kannst, ob sie stimmt, dann teile sie nicht. Bedenke: Die Algorithmen sozialer Medien zeigen vor allem Inhalte, die viel Aufmerksamkeit bekommen – auch wenn sie falsch oder schädlich sind.
Indem du kritisch bleibst, Informationen prüfst und verantwortungsvoll teilst, hilfst du dabei, die Verbreitung von Fake News, Deepfakes und Fehlinformationen zu bremsen.
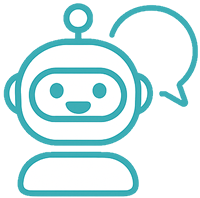
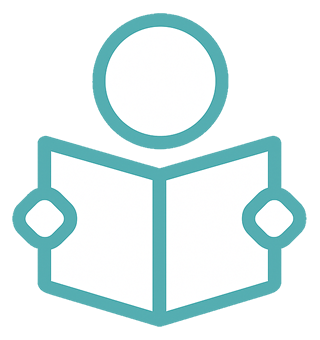
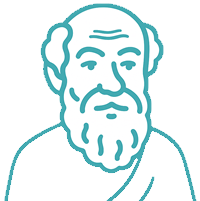


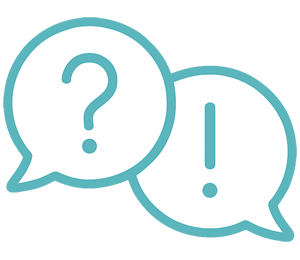
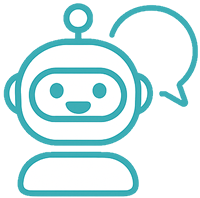
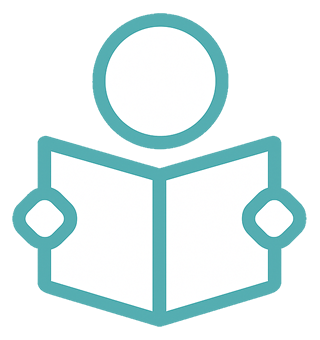
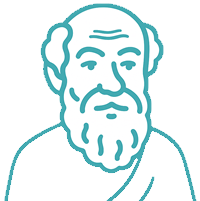


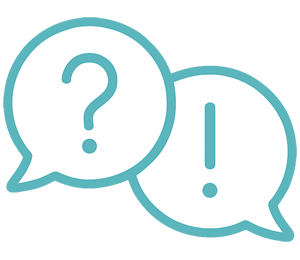
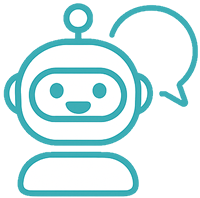
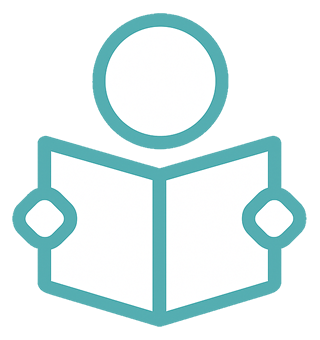
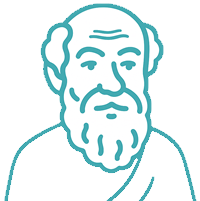


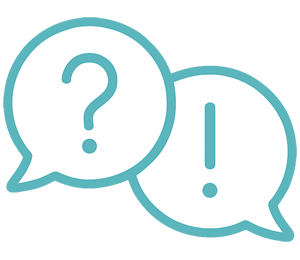
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.