- Jugendliche
- Fachpersonen (Schule, Jugendarbeit...)
- Eltern
-
feel-ok.ch/ai-LKQR-Code für diese Seitehttps://www.feel-ok.ch/ai-LK/

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Lebenskompetenzen als diejenigen Fähigkeiten, «die es den Menschen ermöglichen, ihr Leben zu steuern und auszurichten und ihre Fähigkeit zu entwickeln, mit den Veränderungen in ihrer Umwelt zu leben und selbst Veränderungen zu bewirken».

Überraschungsaufgaben sind Tätigkeiten und Übungen, mit denen Lebenskompetenzen erlebt und trainiert werden können. Im Folgenden werden in Kürze die Lebenskompetenzen beschrieben, für die «feel-ok.ch | Abenteuerinsel» Überraschungsaufgaben bietet.
Für folgende Lebenskompetenzen bietet «feel-ok.ch | Abenteuerinsel» zurzeit noch keine Tätigkeiten an.

Wer die Lebenskompetenzen aufmerksam liest, stellt fest, dass wichtige Begriffe aus der Psychologie wie die Selbstwirksamkeit von Bandura, das Kohärenzgefühl von Antonovsky (mit den drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit), sowie die Theorie der kognitiven Dissonanz nicht erwähnt werden. Diese fliessen stattdessen in die Lebenskompetenzen hinein:
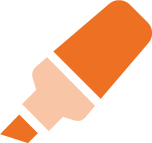
Lebenskompetenzen sind Fähigkeiten. Und Fähigkeiten gelten grundsätzlich als etwas Positives: je mehr man davon hat, desto besser.
Diese Sichtweise wird an dieser Stelle relativiert, um einerseits Abstand von der Illusion des perfekten Menschen zu nehmen, der alles kann und jede Herausforderung mit heldenhafter Bravour meistert, andererseits, um auch für mögliche Risiken von Kompetenzen zu sensibilisieren.
Das Thema ist sehr umfassend und äusserst komplex. An dieser Stelle wird es nur mit einigen Gedanken gestreift.
Priorisierung
Welche Kompetenzen eine Person im Leben braucht, hängt von ihrem sozialen Kontext sowie ihren Bedürfnissen ab. Das Ziel soll nicht sein, jede Fähigkeit bis ins kleinste Detail zu beherrschen, sondern diejenigen zu pflegen und zu fördern, welche für sich und für die Mitmenschen auch relevant sind.
Wechselwirkungen
Darüber hinaus sollen Kompetenzen nicht nur als Eigenschaft einer Person, sondern systemisch betrachtet werden. Eine Kompetenz, die sich in einem vertrauten Bereich bewährt hat, kann scheitern, wenn sich die Lebensbedingungen ändern.
Eine Schülerin kann z.B. im schulischen Setting im Umgang mit sozialen Beziehungen, Prüfungen und schulbezogenen Aufgaben Emotionen optimal regulieren. Wenn plötzlich ihre Mutter an Krebs erkrankt, können unerträgliche Gefühle sie trotzdem aus dem Gleis werfen.
Kompetenzen und äussere Bedingungen (wie das soziale Umfeld) stehen in Wechselwirkung. Entscheidend ist also nicht nur, ob man bestimmte Fähigkeiten hat, sondern welche Aufgaben damit bewältigt werden müssen.
Selbsteinschätzung
Ist eine relevante Fähigkeit zu wenig ausgeprägt, ist es sinnvoll, dies - liebevoll mit sich selbst - zu akzeptieren und daran zu arbeiten. Dies bedeutet aber auch, anzuerkennen, dass man Schwächen hat, anstatt sie zu verdrängen oder mit – für sich oder für andere Menschen – schädlichen Handlungen zu kompensieren, um das eigene Image / den eigenen Selbstwert zu schützen.
Mit sich selbst wohlwollend kritisch zu sein, ist eine zentrale Grundfähigkeit, die verdient hat, als selbstständige Kompetenz aufzutreten (G): eine Fähigkeit, die nicht bei allen Menschen, und – das muss man zugeben – auch nicht bei manchen erfolgreichen Leuten in Führungsposition anzutreffen ist.
Das selbstkritische Denken hat auch eine Schattenseite und diese erkennt man bei Menschen, die Mühe haben, sich selbst und ihre Fähigkeiten zu akzeptieren, d.h. ihren Wert und ihre Stärken zu valorisieren. Sie sind und sie können viel mehr als was sie sich zutrauen. In diesem Fall ist das primäre Ziel nicht die Förderung von Kompetenzen, sondern sich selbst aufzuwerten und das Vertrauen in sich zu steigern. «Mehr können» ist nicht immer der beste Weg: Manchmal ist es besser zu lernen, «sich zu schätzen, so wie man wirklich ist».
Chancen, Risiken und Werte
Kompetenzen sind Chancen, bergen aber auch Risiken. Wie das Dynamit: Das mächtige Instrument kann genutzt werden, um Tunnel zu bohren und weit entfernte Gebiete zu vereinen oder Menschenleben zu beenden.
Ein Beispiel: Die Fähigkeit, empathisch zu sein, kann in einer gut funktionierenden Freundschaft die Beziehung festigen, was als wichtige Ressource für die Bewältigung von schwierigen Herausforderungen gilt. Die gleiche Fähigkeit kann dennoch auch schlimme Auswirkungen haben, wenn diese von jemandem missbraucht wird, um persönliche Vorteile zum Nachteil anderer Menschen zu erzielen.
Die Förderung von Kompetenzen und die Reflektion über die persönlichen Werte, die das eigene Tun prägen, sollten deswegen parallel verlaufen, um die Chance zu vergrössern, dass mehr Kompetenz auch mehr Lebensqualität für sich und für die Mitmenschen bedeutet.
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.